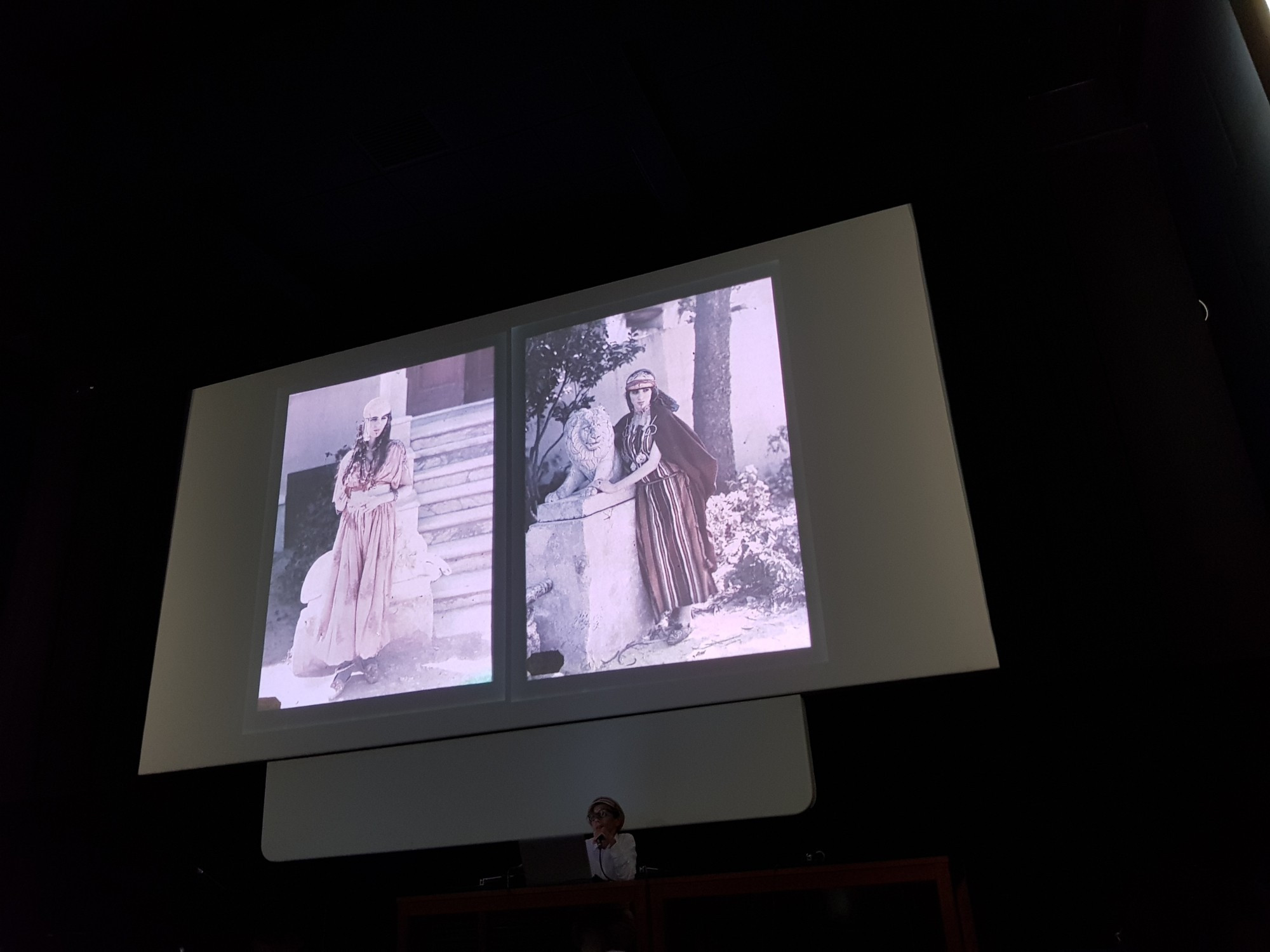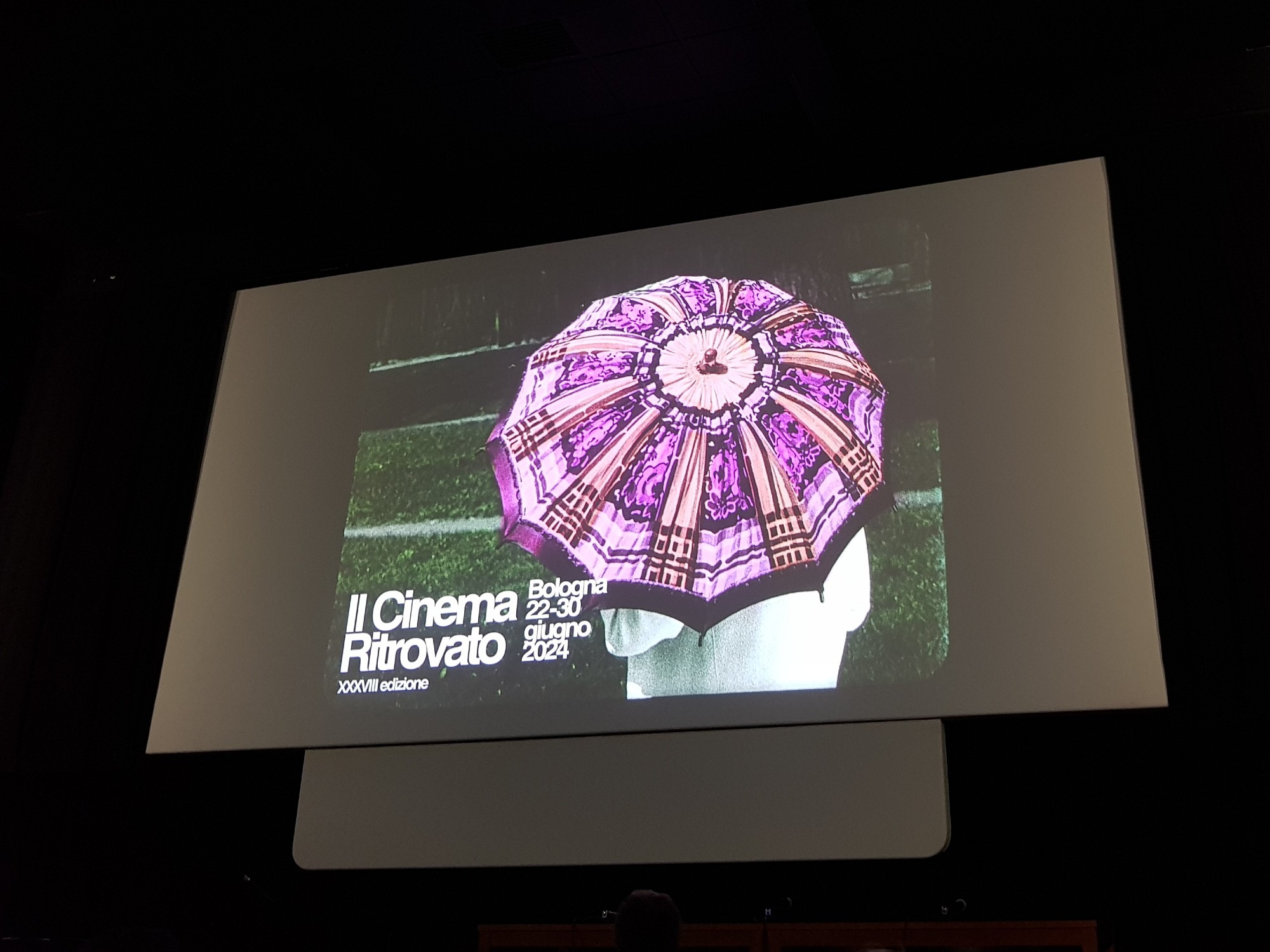|
| Cary Grant and Audrey Hepburn in "Sylvia Scarlett" (George Cukor,1935) - das Festivalsujet der 39. Ausgabe von Il Cinema Ritrovato |
1) PRÄLUDIEN
Die letzten Tage im Kino – oder: Alle guten Dinge kommen zu einem Ende. Die 39. Ausgabe des Festivals "Il Cinema Ritrovato" in Bologna war wieder phantastisch. 9 Tage, 44 Vorstellungen, 80 Filme – falls ich kein Newsreel oder sonstwas übersehen habe. Ich ging es insgesamt etwas ruhiger an als die letzten zwei Jahre, wo ich an den meisten Tagen das Maximum an 6 Vorstellungen pro Tag besucht hatte. Dieses Jahr gab es auch mal nur drei oder vier Vorstellungen und ich liess ein paar Sachen kurzfristig weg, wenn ich nicht mehr mochte. Das Programm verteilt sich auf vier in der Stadt verteilte Kinos sowie die zwei Säle und das Auditorium im von der Cineteca bespielten Cinema Lumière, wo auch das Festivalzentrum mit Buchladen zu finden ist, draussen zudem Catering und abends an einigen Abenden das kleinere der zwei Open Airs. Das grosse, täglich auf der Piazza Maggiore mitten in der Stadt, beginnt am Montag vor Festivalstart und läuft als "Sotto le stelle del cinema" nach Ende des Festivals noch mehrere Wochen weiter. Auf die Piazza und ins Auditorium (wo Vorträge über Restaurationen und Dokumentarfilme gezeigt werden) habe ich es dieses Jahr nie geschafft, dafür zum ersten Mal ins kleine Open Air beim Cinema Lumière, wo ein Projektor mit Kohlenbogenlampe zum Einsatz kommt.
Das Programm war wieder völlig bekloppt – ständig hat man die Qual der Wahl, manche Filme werden zwar wiederholt, viele laufen nur ein einziges Mal. Das Schema ist so, dass in den zwei Kinos in der Stadt (5 Minuten zu Fuss voneinander) morgens zwei (ca. 9 und 11 Uhr), nachmittags drei (ca. 14, 16 und 18:30 Uhr) und abends eine (ca. 21:30 oder 22 Uhr) Vorstellung laufen, in der Cineteca ähnlich (manchmal morgens drei, abends nur in einem Saal oder gar nichts – die ist von den anderen Kinos in weniger als 5 bzw. 10 Minuten zu erreichen), im dritten Kino in der Stadt (dem Europa, in das ich mich quasi reinfalten muss und es drum so gut es geht meide) laufen nachmittags zwei Vorstellungen, die von den Zeitpunkten her nichts in Schema mit den anderen Sälen passen (z.B. 15:30, was dann einen 14 und einen 16 Uhr Slot "kostet") und auch abends gibt es hier eine Extrawurst (zwei Vorstellungen, 20 Und 22:15 – letztere teils restaurierte Porno-Klassiker, dieses Jahr waren da "The Story of Joana" und "Café Flesh" dabei). Im erst letztes Jahr wieder eröffneten Modernissimo, das im Zentrum der Stadt liegt (der Rest westlich und nordwestlich davon, eine Viertelstunde oder mehr von den anderen Kinos entfernt), gibt es auch in etwa das Standard-Schema aber statt Vorstellungen manchmal auch die sogenannten "Lezioni di cinema", dieses Jahr mit Francesca und Paola Comencini, Asghar Farhadi, Jonathan Glazer, Jim Jarmusch, Alice Rohrwacher, Coline Serreau, Robert Wilson usw. (eine solche Veranstaltung habe ich bisher nie besucht, die stehen aber auch alle online auf der Festivalwebsite).
Das Programmschema ist die letzten Jahre immer ähnlich gewesen, ich habe seit 2022 noch keine (Gast-)Kuratorenwechsel erlebt, glaube ich, aber ich bin mehr als zufrieden mit dem Angebot und die Daten für 2026 sind schon wieder notiert. Es gibt drei Programmstränge: in THE CINEPHILES' HEAVEN ist neben der grössten Reihe des Festivals RECOVERED AND RESTORED, die v.a. im Modernissimo, im Arlecchino sowie im Europa und im Open-Air auf der Piazza zu sehen ist, auch eine Retro von LEWIS MILESTONE (die "Classic Hollywood"-Schiene, die Ehsan Khoshbakht programmiert, immer um 11 und 16 Uhr im Kino Jolly), eine Reihe mit Filmen mit KATHARINE HEPBURN (immer um 11 im Arlecchino), eine Retro von LUIGI COMENCINI (im Modernissimo) und eine von COLINE SERREAU (um 18 Uhr im einen Lumière-Saal) sowie die Reihe GREAT SMALL GAUGE, die dieses Jahr komplett auf Musikfilme setzte (auch im Lumière).
Die zweite Schiene heisst THE TIME MACHINE und hier gibt es als Fixpunkte CENTURY OF CINEMA: 1905 sowie ONE HUNDRED YEARS AGO: 1925 (da verschieben die Jahre sich mit jeder Ausgabe und beide Reihen laufen v.a. in den Lumière-Sälen), dazu DOCUMENTS AND DOCUMENTARIES (verteilt auf die Lumière-Säle, das Modernissimo, das Europa und das Auditorium).
Die dritte Schiene ist THE SPACE MACHINE und hier programmieren zwei Skandinavier seit längerem eine japanische Reihe, die dieses Jahr den in der Regel übersehenen Vorkriegsfilmen von MIKIO NARUSE gewidmet war (um 18 Uhr im Kino Jolly). Auch die Reihe CINEMALIBERAO (14 Uhr im Jolly) ist ein Festivalfixpunkt, der für mich immer Highlights bietet (dieses Jahr stammten die Filme aus Sri Lanka, dem Libanon, dem Iran, aus Kolumbien, Tunesien, Guinea Bissau sowie Brasilien). Dazu kamen dieses Jahr die Reihe ISAAK BABEL – ODESA STORIES, MASKS AND MUSIC: THE FILMES OF WILLI FROST und NORDEN NOIR (skandinavische Noirs).
Am letzten Tag, Tag 9, dem zweiten Sonntag, laufen nur noch die Projektoren im Arlecchino und im Modernissimo – und da gibt es dann auch nur noch Wiederholungen. Ein guter Punkt, um die Programmplanung zu starten und darum herum dann den Rest zu gestalten. Dieses Jahr fühlte es sich schon am Samstag fast so an, als sei das Festival zu Ende: die Säle plötzlich nicht mehr gut bis komplett gefüllt. Aber ich bleibe, wenn ich es einrichten kann, immer für die ganzen neun Tage, kam dieses Jahr auch schon wieder am Freitag und (und erwischte so immerhin noch einen Film von Coline Serreau, "Chaos", der im Vorprogramm lief, das – wie das Open Air auf der Piazza – schon ab Montagabend begann).
Mein Programmschema war in der Regel: um 9 eine Wiederholung im Jolly (oder gar nichts), um 11 im Jolly erstmals Milestone, um 14, 16 und 18 Uhr ebendort Cinemalibero, Milestone und Naruse, und abends mal gar nichts oder eine Wiederholung irgendwo – weil ich nachmittags auch mal im Europa oder in den Lumière-Sälen war. Die Milestone-Retro habe ich bis auf "All Quiet in the Western Front" (den es je einmal in der Stumm- und Tonfassung gab) komplett gesehen, die Naruse-Reihe ebenfalls (bei den restaurierten hätte es noch "Floating Clouds" gegeben, aber den habe ich vor Jahren schon mal gesehen – eben: die ewige Qual der Wahl), dann habe ich wieder fast die ganze Cinemalibero-Reihe angeschaut, dazu ein paar der Musikfilme in der Small Gauge-Reihe, ein paar Stummfilmprogramme (1905 und 1925), ein paar Babel/Odesa-Filme, ein paar restaurierte Filme … weder Milestone noch Naruse waren Offenbarungen (mit Ausnahmen), aber beides tolle Reihen (bei Classic Hollywood sind Litvak von 2024 und noch mehr Mamoulian von 2023 meine bisherigen Highlights, 2022 war ich schon für Fregonese hier, hab aber nicht das ganze Festival besucht; bei den Japan-Reihen war bisher 2024 mit Yoshimura mein Highlight). Bei Cinemalibero gab es wie üblich Entdeckungen, aber auch da fand ich dieses Jahr die Ausbeute etwas geringen (2023 war die Reihe besonders toll, auch dank zweier Filme von Bahram Beyzaie, der auch 2025 wieder mit einem tollen Kurzfilm vertreten war).
Völlig verpasst habe ich leider NORDEN NOIR und MASKS AND MUSIC: THE FILMS OF WILLI FORST, dazu auch LIFE FIRST! THE CINEMA OF LUIGI COMENCINI und (fast) COLINE SERREAU, LIKE A FISH WITHOUT A BICYCLE … ich war nie auf der grossen Piazza und habe entsprechend die grossen Cineconcerti dort auch verpasst … aber Stummfilme mit hervorragender Begleitung sah ich eine ganze Menge.
 |
| Cinema Lumière, Bologna |
2) SORROW AND PASSION: PRE-WAR MIKIO NARUSE
Otome Gokoro Sannin Shimai (Three Sisters with Maiden Hearts) (1935) * * *1/2
Tsuma Yo Bara No Youni (Wife, Be Like a Rose!) (1935) * * * * *
Uwasa No Musume (The Girl in the Rumour) (1935) * * *1/2
Kimi To Yuku Michi (The Road I Travel with You) (1936) * * *1/2
Nyonin Aishu (A Woman's Sorrows) (1937) * * * *1/2
Nadare (Avalanche) (1937) * * * *
Kafuku (Zenpen & Kohen) (1937) * * * *
Hataru Ikka (The Whole Family Works) (1939) * * * *
Magokoro (Sincerity) (1939) * * *1/2
Verfilmungen von Romanen, Auftragsarbeiten, viel gutes Handwerk – aber auch immer wieder faszinierende Frauenbiographien, einfühlsame, oft toll gemachte Filme. Im Hintergrund nimmt das Kriegsrauschen allmählich Fahrt auf, Japan war Besatzungs- und Kolonialmacht: wenn das reiche Mädchen in Magokoro (auf der Ebene der Mädchen verdient der Film einen Stern mehr) am Ende vor Freude fast nicht mehr kann, als ihr Vater in den Krieg ziehen darf (er ist vermutlich auch der Vater des armen Mädchens) – ist das echt schwer auszuhalten. Dafür ist der erste Film von 1939, Hataru Ikka, die Adaption einer proletarischen Novelle und wie es scheint ein durchaus riskantes Projekt damals: die ungeschönte Darstellung der Schwierigkeiten einer armen Familie, den Alltag zu bewältigen, Entscheidungen zu fällen ohne deren Tragweite wirklich abschätzen zu können.
Das Dilemma zwischen Wünschen der Figuren und ihrer Rückbindung oder Verhinderung durch die Familie, die Gesellschaft, die Tradition, ist ein Dauerthema in den Filmen. Frauen werden als nette Dekorationsobjekte behandelt oder als Rettung des elterlichen Geschäfts – über die Söhne, die oft keine so gute Figur machen (manchmal auch eine ganz schlechte) wird aber ebenso verfügt wie über die Töchter. Der Blick von Naruse, seine Sympathie, liegt aber auch hier schon unverkennbar bei den Frauen (manchmal auch bei den Müttern und ihren Anstrengungen, in der feindlichen Gesellschaft zu bestehen).
Am Ende schon eine sehr tolle Reihe von Filmen – mit erwartbarem Höhepunkt, dem einzigen Film, den ich auch schon kannte, aber im Kontext der anderen unbedingt noch einmal sehen wollte, Wife, Be Like a Rose!, der zu Recht zum Klassiker geworden ist. Nyonin Aishu hätte das durchaus auch verdient, finde ich. Schön war, dass fast alle Filme als 35mm-Kopien gezeigt wurden (es gibt davon wohl gar keine Digitalisate/Restaurierungen) – auch "Wife, Be Like a Rose!" in einer körnigen, oft etwas unscharfen Kopie… die Qualität der Bilder ist einfach unschlagbar!
3) LEWIS MILESTONE: OF WARS AND MEN
The Racket (1928) * * * *
Rain (1932) * * * *
Hallelujah, I'm a Bum (1933) * * *1/2
The Captain Hates the Sea (1934) * * *1/2
Of Mice and Men (1939) * * * * *
Edge of Darkness (1943) * * * *
The North Star (1943) * * *1/2
A Walk in the Sun (1945) * * * *1/2
The Strange Love of Martha Ivers (1946) * * * *
Arch of Triumph (1948) * * *1/2
The Red Pony (1949) * * *
Verpasst habe ich: "The Garden of Eden" (1928) und "All Quiet on the Western Front" (1930, stumm und ton)
Lewis Milestone? Ich hatte den Namen tatsächlich noch nie gehört, bevor das Festivalprogramm veröffentlich wurde. Mein frühester war der Gangsterfilm, der anscheinend die italo-amerikanischen Mobster-Figuren erst ins Hollywoodkino einführte, The Racket – von Neil Brand hervorragend begleitet (er ist der erste, der den üblen E-Piano-Synthesizer im Jolly wirklich zum Klingen brachte … die meisten Stummfilmvorführungen laufen in den Lumière-Sälen, dort gibt es einen Yamaha Baby Grand bzw. immerhin ein Upright-Piano). Auch Rain fand ich sehr stark. Regen fällt auf durchnässten Boden – alles sehr fühlbar, als könne man die nasse Erde ertasten. Und Erde ist das Element von Milestone, in den Kriegsfilmen, in der grandiosen Antithese zum mythischen verklärenden Kino des überragenden Kinojahres 1939 ("Wizard of Oz", "Gone with the Wind", "Stagecoach"), im bekloppten hart rassistischen Republic-Western … in "Rain" verdreht Joan Crawford einem steifen Missionaren den Kopf – ein tolles Pre-Code-Vergnügen, auch wenn die vorgeschobene Läuterung und dann die Auflösung, dass das alles nur Theater war, nicht besonders gelungen inszeniert wurde.
Der erste Film, den ich aus der Reihe sah, war das antikapitalistische Rodgers/Hart-Musical Hallelujah, I'm a Bum, ein Starvehikel für Al Jolson – und ein Projekt, das davor schon gescheitert war, bevor Milestone an Bord geholt wurde und von ganz vorn begann. Da ist der Blick auf die Menschen am Rand der Gesellschaft, ebenso typisch wie die Tracking Shots – und da ist "You Are Too Beautiful", ein Song, der später zum Jazzstandard geworden ist. Der im Schtetl von Seredžius (Kovno, heute Litauen) geborene Sohn eines Kantors glänzt in diesem Film, der überaus schwungvoll ist, zwischen Spass und Satire schwankt – aber leider an der Kasse floppte und natürlich nicht hilfreich war, als Milestone später ins Visier der Antikommunisten geriet. Bemerkenswert sind in fast allen Filmen die starken Ensembles mit sehr vielen Sprechrollen, so in der Komödie The Captain Hates the Sea, dem einzigen Columbia-Film von Milestone, in dessen Saufgelagen John Gilbert sich quasi selbst spielt (er soff sich 1936 dann wirklich zu Tod – der Milestone-Film war schon seine letzte Chance für ein Comeback, fast der ganze weitere Cast animierte ihn beim Dreh tatsächlich zum Trinken … und es folgte kein weiterer Film mehr). Der tollste dieser Ensemble-Filme ist zweifellos Of Mice and Men, den es tollerweise auch in einer Sepia-Kopie (wie damals) zu sehen gab, nicht in einer üblichen s/w-Verleihkopie. Ein wahnsinnig beeindruckender Film, von der Musik von Aaron Copland bis zu den tollen Aufnahmen voller "Frame im Frame"-Shots.
In Edge of Darkness (Musik von Waxman) erhebt sich ein norwegisches Küstendorf gegen die Nazi-Besetzung und hier dann erstmals ausführliche Kriegs- und Kampfszenen (inklusive Pfarrer, der vom Kirchturm aus das Hinrichtungskommando niedermäht). In North Star (wieder Copland) wird eine sowjetische Idylle, die fast schon die prosperierend biederen US-Fünfzigerjahre vorwegzunehmen scheinen, auch wenn die liebende blonde Kernfamilie vom glücklichen Frühstück nahtlos zur fröhlichen Kollektivarbeit wechselt) jäh durch den deutschen Angriff vernichtet. Arch of Triumph spielt dann im Milieu der papierlosen Flüchtlinge in Paris – und vermag nicht wirklich zu überzeugen – die erste Fassung, die bei Previews durchgefallen ist, dauerte 224 Minuten, Milestone kürzte danach auf 115, aus den UCLA-Archiven konnten 18 Minuten rekonstruiert werden … die Figurenzeichnung und die ganze Erzählkonstruktion funktionieren in dieser Mischung aus Kriegs- und Liebesdrama, aus Tragödie und Noir, nur einigermassen.
A Walk in the Sun, in dem ein Platoon in Süditalien landet und 10 Meilen durchs offene Feld bis zu einem Bauernhaus gehen muss, das zu erobern ist, war dann das zweite grosse Highlight. Einmal mehr ein grandioser Ensemblefilm mit starken Dialogen (Robert Rossen), wieder die Erde, der Boden, der Dreck, der Staub – und die Leere, die Sinnlosigkeit, das Warten, die Angst, der Zusammenbruch, das Weitermachen trotz allem … toll. Der einzige Noir von Milestone, The Strange Love of Martha Ivers mit Barbara Stanwycks dominanter Titelfigur, ist mässig gelungen – Milestone konnte allem Anschein nach sexy überhaupt nicht und das wäre hier halt schon recht wichtig gewesen. Regen gibt es auch wieder, und die Figur, die durch den Film führt (und diesen auch einigermassen trägt), Van Heflins Sam Masterson, kommt von "the other side of the tracks", was anderswo beim Festival noch eine zentrale Rolle spielte.
Die Kuriosität dann zum Schluss (mein zweiter oder dritter allerdings), The Red Pony, ein Technicolor-Farbfilm mit recht irren Special Effects aus der Küche des Republic Studios, einmal mehr mit toller Musik von Aaron Copland und dieses Mal direkt in Zusammenarbeit mit John Steinbeck entstanden. Ein Western, ein Coming-of-Age-Film über Mobbing, das erste eigene Pony, ein recht guter Robert Mitchum neben der eh immer blendenden Myrna Loy … ein paar unendliche rassistische Momente, wie es sich für das Genre gehört (der Junge will den Grossvater, der ständig dieselben alten Frontier-Geschichten wiederholt – eine tolle Figur, gespielt von Louis Calhern) zum Ausräuchern von Mäusen mitnehmen, dieser meint, das sei wie damals mit den Rothäuten gewesen, die hätten keine Chance gehabt) … ein Happy-End natürlich auch, zumindest für den Jungen und vorgeblich auch für Loy und ihren liebenswert-dödligen Lehrer-Ehemann (Shepperd Strudwick), den im Städtchen niemand akzeptiert (auch der Junge, der nach dem Vater kommt, schaut zum ruppigen Mitchum auf). Fazit? Auf jeden Fall toll, diese Filme entdecken zu können, auch wenn manche von ihnen nicht wirklich überzeugen können oder deutliche Schwächen haben. Und daheim dann endlich mal ausgiebiger Aaron Copland hören!
 |
| Sessel im Cinema Modernissimo - jeder ist einer Persönlichkeit aus der Kinogeschichte gewidmet. |
4) CINEMALIBERO
La Paga (Ciró Durán, CO/VZ 1962) * * * *
São Paulo, Sociedade Anônima (Luis Sérgio Person, BR 1962) * * * *
Postschi (Dariush Mehrjui, IR 1972) * * * *1/2
Safar (Bahram Beyzaie, IR 1972) * * * * *
Uirá, um Índio em Busca de Deus (Gustavo Dahl, BR 1973) * * * *
O Regreso de Amílcar Cabral (Sana Na N'Hada, GW 1976) * * *1/2
Gehenu Lamai (Sumitra Peries, LK 1978) * * * *1/2
Ghazl El-Banat (Jocelyne Saab, LB/FR 1985) * * * *
Rih Es-Sed (Nouri Bouzid, TN 1986) * * * *1/2
Mortu Nega (Flora Gomes, GW 1988) * * * *
Verpasst habe ich: Al Õrs (Collectif Nouveau Théâtre de Tunis, 1978)
Auch hier: kein richtiger Ausfall dabei (ich überhörte aber wen, der ausgerechnet den Film, den ich verpasste, "Al Ôrs" also, als "zwei Stunden Folter" empfand) … aber auch nicht die ganz ganz grossen Entdeckungen. Wie üblich handelt es sich allesamt um kürzlich restaurierte Filme, meistens 4k Digitalisate, die dann allesamt auch als DCP gezeigt wurden. Das Highlight war sicher Safar, der 35minütige Film von Beyzaie, in dem ein Waisenjunge seinen Freund überredet, sich bei der Arbeit aus dem Staub zu machen, um – wieder einmal – eine Adresse aufzusuchen, an der angeblich seine Eltern leben. Wie im Lauf des Films klar wird, ist nicht der erste solche Versuch – und es wird nicht der letzte bleiben. Der Film wurde für "Kanoon" gedreht, das Institut für die intellektuelle Entwicklung von Kindern und junger Erwachsener. Üblicherweise entstanden dort positive Filme, die eine Botschaft transportieren (letztes Jahr gab es in der Cinemalibero-Reihe "Entezar" von Amir Naderi, der besser ins Schema passt). Das ist bei "Safar" aber nicht der Fall – eher ist das eine bildgewaltige Odyssee (farbig sind die Filme hier erst ab 1973, wobei der von 1978 nochmal s/w ist), ein Trip aus dem Zentrum von Teheran an die Ränder, durch immer schäbigere Viertel, vorbei an Filmplakaten, durch Märkte und Müllhalden, mit nicht immer erfreulichen Begegnungen, hinaus in die Vorstädte, wo der Junge am Ende ein paar antrifft, das tatsächlich einen Sohn vermisst, der aber einige Jahre jünger ist … ein Film über das Sehen, den Blick – und darin liegt vielleicht auch eine Art Optimismus.
Der Film, eine Art Vorbote des Third Cinema, lief zusammen mit La Paga, einem sozialkritischen Film, der damals boykottiert wurde (weil er subversiv sei und gegen die verfassungsmässige Ordnung Venezuelas verstosse). Die Bildsprache ist vom Neorealismus ebenso wie vom sowjetischen Kino geprägt, es gibt archetypische Figuren, eine ganz einfache, sich unaufhaltsam abspulende, tragische Handlung: die Ausbeutung, der Hunger, die Krankheit des Kindes, die betrügerischen Händler im Dorf und dessen Honoratioren, die das Christentum trefflich als Disziplinierungs- und Unterdrückungsinstrument einzusetzen wissen – und das alles in sehr starke Bilder gepackt. Ein Gegenpol dazu ist São Paulo, Sociedade Anônima, in dem ein opportunistisches Arschloch Affären hat, Aufstiegschancen sucht, bei einem korrupten neuen Chef anheuert und dessen Geschäft nach vorn treibt … und dabei doch immer seltsam passiv bleibt, und schliesslich – weil er trotz seiner nie wirklich beeinträchtigten Handlungsfähigkeit ein Getriebener ist – ausbricht, seine Frau verlässt, mit einem gestohlenen Auto aus der Stadt hinausfährt, nur um sich am Ende von einem Lastwagenfahrer wieder zurückfahren zu lassen … ein Film, der in seinem Sexismus (in schöne Antonioni-Bilder gepackt – aber die moderne unabhängige frivole Frau ist auch nur eine Opportunistin, die jede Chance nutzt, um weiterzukommen) stellenweise hart auszuhalten ist, aber sich am Ende doch zu einer recht guten Geschichte zusammenfügt. (Witzig: bei Strassendrehs gucken ständig Leute irritiert in die Kamera oder drängen sich im Hintergrund nochmal ins Bild … bei einer kurzen Szene in einem Park sieht man auch ein Absperrband mit Statisten davor und Passantinnen dahinter.)
Aus Lateinamerika gab es dann noch eine faszinierende Odyssee, nämlich Uirá, um Índio em Busca de Deus, die Reise des Stammeshäuptlings, der nach dem Tod seines Ältesten nicht mehr wie gehabt leben mag – er geht auf die Jagd, aber mag nicht mehr töten – und von den Medizinmännern auf die Suche nach Gott geschickt wird. Mit Frau und den beiden jüngeren Kindern zieht er los, begegnet Missionaren, anderen indigenen Gemeinschaften und kommt schliesslich in eine Art Stadt. Die kleine Tochter geht irgendwann verloren, Kommunikation mit den Besetzern ist mangels gemeinsamer Sprache unmöglich – bis ein Beamter von der Behörde zum Schutz der Indios auftaucht (von Regisseur Dahl gespielt) – doch die Missverständnisse lassen sich natürlich auch nicht ausräumen, indem man die dreiköpfige Familie in Kleider steckt, im Hotel unterbringt und bei Pressekonferenzen vorzeigt. Im Katalog ist zum von der Rai koproduzierten Film ein Text zu finden, den Glauber Rocha 1987 geschrieben hat: "Cineanthropology – a modern linguistic practice par excellence. Uirá, the story of an Indian who sets out in search of God, a rare cosmogony in our cinema, is a film structured in medium shots, according to the rhythms of a synthesis produced by the dialectical montage of humanists like Rossellini and Bresson and historical materialists like Brecht. Flowing without the phenomenological accidents of a naturalistic river, Uirá, from the pure theory of universal cinema to cultural specificity, closes another cycle of modern Brazilian cinema, which began after 1968 with another Indianist film: Como era gostoso o meu francês, by Nelson Pereira dos Santos … Uirá masterfully employs the general theories of Cinema Novo and reincorporates the actor into reality, opens up avenues that eschew the complacent confusion between repression and creation, and points to the real as an object revealed by discourse that integrates scientific information and poetic transcendence. Uirá is the funeral of a civilisation that – as Sérgio Buarque de Hollanda recalls – did not have the strength to mobilise its own history. As a result, the Indians become the enemies of another History, which sings its glories in blood. In Tupi and Portuguese – since the actors play in a language stripped of all conceptual drama – Uirá laments, with the rigour of the moralists, the lack of generosity of those who have conquered in the name of the Faith and the Empire."
Im Nahen Osten ging es für mich mit der Reihe los – neben dem erwähnten "Safar" gab es den tollen Ghazl El-Banat, in dem Jocelyne Saab eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Krieges im Libanon erzählt, eine Geschichte, wie nur der Krieg sie schreiben konnte, dazwischen immer wieder echte Kriegsaufnahmen, die Saab als Dokumentarfilmerin gemacht hatte. Ein besonderer, poetischer Film - mit Musik von Siegfried Kessler. Der andere Film der iranischen New Wave, Postschi von Dariush Mehrjui, ist eine unglaubliche Adaption von Büchners "Woyzeck". Ein Pöstler, führt Gelegenheitsjobs für den lokalen Grundbesitzer durch und lässt sich gegen seine Impotenz vom lokalen Quacksalber-Tierarzt behandeln. Die zwei verspotten und demütigen ihn bei jeder Gelegenheit, der aus dem Ausland zurückkehrende Sohn des Grundbesitzers verführt dann auch noch die Frau des Pöstlers. Ein allegorischer, wuchtiger und doch sehr zarter Film, der zwischen Drama und Satire schwankt, sich in seiner Form immer mehr dem kruden Denken des allmählich in Irrsinn abdriftenden Pöstlers anzunähern scheint – und damit bei allem eleganten Genre-Hopping davor eine Stringenz erhält, die wirklich mitreissend ist.
Rih Es-Sed von Nouri Bouzid war der letzte Film aus der Reihe, den ich sah – und noch ein Höhepunkt. Ein Film, der Tabus brach, in dem Homosexualität und auch Missbrauch von Jungen durch eine Autoritätsfigur thematisiert. Alles bricht auf, als einer von zwei engen Freunden heiraten soll, sich in Erinnerungen verliert, auszubrechen versucht, während der andere Freund sich selbst mit Graffitis denunziert (er sei kein richtiger Mann), um alle Brücken abzubrechen. Trinken mit den Freunden, ein Besuch im Bordell, ein Besuch beim alten Juden, der ihm das Oud-Spiel beibrachte und sein Instrument schenkt – ihm will die Hauptfigur die Missbrauchsgeschichte erzählen, doch der Alte schläft ein – und ist am nächsten Tag gestorben. Ein Film, der vieles nur andeuten und kann, aber dabei doch überraschend deutlich wird.
Aus Guinea-Bissau gab es dieses Jahr die halbstündige Reportage O Regreso de Amílcar Cabral über den Tod von Amilcar Cabral. Der Regisseur war anwesend und betonte die Arbeit im Kollektiv, zu dem auch Flora Gomes gehört hat, von der im Anschluss der tolle Mortu Nega ("vom Tod abgewiesen" oder so ähnlich) lief, ein Spielfilm, der in derselben Zeit spielt (die Nachricht von Cabrals Ermordung ist in die Handlung eingebettet) und den Alltag der Kämpfer und sie unterstützenden Zivilist*innen zum Thema hat – aber auch die Zeit nach dem Krieg, als die einstigen Gefährten sich teils weiter unterstützen, teils aber auch verleugnen.
Es bleibt Gehenu Lamai, das Debut von Sumitra Peries aus Sri Lanka – in betörendem Schwarzweiss gedreht, ein weiterer Coming-of-Age-Film um zwei Freundinnen und eine unmögliche, zart aufkeimende Liebe, die nicht sein darf. Männer spielen in dem Film kaum eine Rolle (letztlich auch das love interest der Hauptfigur nicht wirklich), irgendwann gibt es plötzlich mal den kranken Vater zu sehen, der völlig hilflos herumliegt und jammert. "Girls" heisst der Film international und das war für mich einer der schönsten, zartesten Filmes Festivals – unglaublich schöne Bilder, fast jedes Frame könnte man an die Wand hängen … und dabei wirkte das doch alles viele eigener als die männlichen Kollegen, die bei Antonioni, beim Neorealismo oder sonstwo abguckten. Peries war mit dem Regisseur Lester James Peries verheiratet, machte noch neun oder zehn weitere Filme (bis 2018 lauf dem frz. Wiki-Eintrag), wirkte in den Neunzigern als Botschafterin ihres Landes (1995 bis 1999 in Frankreich, zudem in Spanien bei der UNO) und und starb leider 2023, bevor ihr Debut mit Unterstützung der Film Foundation im Labor von L'Immagine Ritrovata restauriert wurden.
5) WEITERES AUS THE TIME MACHINE & THE SPACE MACHINE
An manchen Tagen war ich nur halb auf meinen Schienen unterwegs, einen Tag verbrachte ich sogar ganz ohne Besuch im Jolly (Milestone, Naruse, Cinemalibero – alle Filme konnte ich zum Glück jeweils zu einer anderen Zeit sehen). Die meisten Besuche galten dann den beiden Sälen im Cinema Lumière, wo wie erwähnt die meisten Stummfilmvorführungen stattgefunden haben. Hier vermischten sich die Stränge auch einmal – was sie genau genommen eh ständig tun, weil ja auch in den anderen Reihen (besonders bei Cinemalibero) frisch restaurierte oder wieder aufgefundene und im Anschluss restaurierte Filme gezeigt werden.
Schon am Samstag war ich für die Spätvorstellung im Modernissimo: Komissar (Aleksandr Askoldov, SU 1967)* * * *1/2 war der späteste Film aus der Reihe ISAAK BABEL – ODESA STORIES. Askoldov (1932–2018) konnte keinen weiteren Film machen, weil die Geschichte um eine schwangere Kommissarin, die ihre Einheit im Bürgerkrieg verlassen muss und bei einem armen jüdischen Schmied und seiner Familie unterkommt, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Die Konfliktlinien – Bolschewistin vs. Zivilistin (Mauser-Pistole vs. Baby), das Ideal der Gleichheit, des Dienstes am Vaterland … die Angst der jüdischen Familie vor neuen Pogromen durch die Weissen, als die Front allmählich auf Berdytschiw (in der heutigen Ukraine) zukommt … Askoldov hat viel in seinen Film gepackt, doch dieser packt ebenfalls sehr, der heroische Realismus sowjetischer Art wird zurückgebunden durch die allmähliche Annäherung der zu Beginn sehr männlich dargestellten Kommissarin, die von ihren Kollegen den Respekt verliert, je weiter diese Annäherung vonstatten geht – und die am Ende das Kind zurücklässt, um sich wieder den Truppen anzuschliessen. Verboten und – wie man dem mit Berufsverbot und Parteiausschluss bestraften Regisseur sagte vernichtet – , wurde der Film anscheinend, weil Askoldov sich geweigert hatte, die Ethnizität der Familie zu verschweigen, bei der die Kommissarin unterkommt (die Vorlage stammt von Wassili Semjonowitsch Grossman, der aus Berdyschiw stammte und in einer weltlichen jüdischen Familie aufgewachsen war). Der Film kommt mit einen starken Soundtrack von Alexander Schnittke, der vermutlich (meine Annahme) auf Volksmusik zurückgreift. Erst 1986 konnte der Film erscheinen – und erhielt u.a. 1988 den Silbernen Bären.
Einen Tag später musste ich um 11:30 ins Lumière, um Grass: A Nation's Battle for Life* * * * vom Gespann Meriam C. Cooper und Ernest Schoedsack sowie Marguerite Harrison (US 1925) zu sehen. Das Trio nähert sich im ersten Drittel des 1924 gedrehten, einstündigen Dokumentarfilms allmählich dem Geschehen an, sucht nach einem "vergessenen" Stamm, der allerdings keineswegs vergessen war sondern durch ihre Lebensweise für ständige Spannungen mit der iranischen Regierung sorgte. Die Filmemacher finden den Stamm und ihren Anführer Haidar Khan schliesslich im Südwesten des Landes und schliessen sich der Frühlingswanderung, bei der fast 50 Tage lang unfassbare Bilder gedreht wurden: es geht durch weite Steinwüsten, über den reissenden Karun (mit aufgeblasenen Ziegenfellen), ohne Hilfsmittel und teils barfuss über den 4200 hohen Zard-Kuh – und das alles mit 50'000 Menschen (Alten, Kindern, Frauen mit grossen Tragekörben und Säuglingen auf dem Rücken) und einer halben Million Tieren. Der Stammesführer sowie der wenige Tage später von einem Mob in Teheran getötete US-Vizekonsul bestätigen mit einer im Film zu sehenden Urkunde, dass das Filmteam die ganze Wanderung mitgemacht habe. 1925 endete die Qajar-Dynastie (und starb auch Haidar Khan, wie es scheint an Gelbfieber) und Reza Schah Pahlavi übernahm die die Macht im Land. Der Film wurde im Iran nie gezeigt – vielleicht weil er dem neuen Herrscher die Schuld an der Ermordung Imbries gab. Als Vorfilme liefen zwei Kurzfilme, "Sur la Route du Pôle Nord" (FR 1925, 1') über Roald Amundsen vor dem Aufbruch zu einem scheitern sollenden Nordpolflug und ein Werbefilm für "The Lost World" (USA 1925, 4'), in dem u.a. gezeigt wird, wie das Puzzle, das extra zur Promotion des Filmes entwickelt wurde, gelöst werden kann. Begleitet hat das ganze einer meiner liebsten Stummfilmbegleiter, Stephen Horne, am tollen kleinen Yamaha-Flügel und an der Querflöte.
Evrejskoe Scaste (Jewish Luck, Jidische Glikn) (Aleksej Granovskij, 1925) passte zur Cento Anni Fa-Schiene und gehörte auch zur Babel/Odesa-Reihe, da Isaak Babel zu den Drehbuch-Autoren gehörte. Auch der Film ist in Berditschew, im Schtetl, angesiedelt, basiert auf den "Menachem Mendel"-Briefen von Scholem Alejchem und handelt von der Suche nach Glück, eben dem jidische Glikn. Solomon Michoels, einer der wichtigsten Vertreter des jiddischen Theaters (er gehörte zur Truppe, die Granowski leitete), spielt die Hauptrolle des erfolglosen Glücksuchenden – und auch wenn die Protagonisten ihr Glück mit zwei Ausnahmen (es gibt ein Happy-End, die unmögliche Heirat findet als Rettung in der Not statt) nicht finden – die Begegnung des jiddischen Theaters mit dem sowjetischen Kino ist ein echter Glücksfall. Mendel versucht sich als Verkäufer von Korsetten und Krimskrams, von Lebensversicherungen und am Ende auch als Matchmaker, als Heiratsvermittler. Es geht schief, was nur schief gehen kann, während sein Sidekick in die Tochter eines reichen Juden aus Berditschew verliebt hat … eine der grossartigen Szenen der Kinogeschichte schenkt uns der Film, wenn Mendel bei einer Zugfahrt einschläft und davon träumt, wie er im Alleingang das "Brautproblem" der USA löst, nämlich mit einem Einspieler, in dem jüdische Bräute quasi maschinell und in Masse in die USA verschifft werden – Surrealismus trifft jiddisches Theater trifft den sardonischen Humor von Babels Zwischentiteltafeln und die Kamera von Eduard Tisse (der auch bei "Streik" und "Panzerkreuzer Potemkin" mitwirkte – beide auch im Programm dieses Jahr). Die Begleitung besorgten dieses mal Gabriel Thibaudeau (Klavier) und Silvia Mandolini (Violine) – und die war so ausgereift wie grossartig, natürlich mit vielen östlichen Anklängen und den entsprechenden Tänzen.
Die erste Vorstellung, die ich beim kleinen Open-Air bei den Lumière Kinos (auf der Piazzetta Pier Paolo Pasolini) schaffte, war ein weiterer Glücksfall: The Salvation Hunters* * * * *, "a film about thought", das Debüt von Joseph von Sternberg aus dem Jahr 1925 – ein so poetischer wie harter, realistischer Film, der nichts weniger wollte, als das Handwerk der Avantgarde in Hollywood heimisch zu machen. Es gibt drei Schauplätze im Los Angeles von 1924. Los geht es am Hafen, wo George K. Arthurs "boy" herumlungert, die herumsitzende Georgia Hale (die Frau) trifft und den Jungen (Bruce Guerin) rettet. Zu dritt ziehen sie los, kommen in Downtown L.A. in einer schäbigen Absteige unter, in der sie vom "grosszügigen" Vermieter quasi eingesperrt, ausgehungert werden, um die Frau gefügig zu machen. Zu fünft brechen sie dann aufs Land auf (sie fahren ins Valley, damals noch eine grosse leere Wiese), wo sich die Rettung des Kindes durch den boy vom Anfang wiederholt und die drei sich am Ende losreissen können und die Strasse runter gehen, einer besseren Zukunft entgegen. Auch davor gab es wieder zwei Kurzfilme, zuerst einen avantgardistischen Werbefilm, schlicht "Film" betitelt (Guido Seeber/Julius Pinschewer, DE 1925, 1′) und dann "Bonzolino or Bonzo Broadcasted" (William A. Ward, UK 1925, 7′), ein Zeichentrickfilm, in dem sich ein Hund aus England via Radiowellen nach Hollywood transponiert und dort nach mehreren Reinfällen und einer Begegnung mit Charlie Chaplin (der natürlich Georgia Hale bei Sternberg entdeckt hatte) einen Vertrag erhält und so nach dem Radiowellen-Trip zurück über den Ozean die Herzensdame gewinnen kann. Begleitet wurde das alles einmal mehr hervorragend von einem Trio, das so zuvor noch nicht zusammen gespielt hatte und sich Dreamscope Trio nannte: Matti Bye (Celesta, Synthesizer), Laura Naukkarinen (Elektronik, Stimme) und Eduardo Raon (Harfe, Elektronik).
Auch aus dem Jahr 1925 stammt Prem Sanyas* * * * von Franz Osten, eine deutsch-indische Koproduktion, die darauf zurückgeht, dass der indische Rechtsanwalt Himanshu Rai in die Passionsspiele in Oberammergau erlebte und die Idee hatte, die Filme über die Weltreligionen in indischen Settings zu machen. Er lernte in Bayern auch Franz Osten kennen, was zu einer eineinhalb Jahrzehnte dauernden Zusammenarbeit mit drei langen Stummfilmen und sechzehn in Bombai für Rais Produktionsfirma Bombay Talkies produzierten Tonfilmen führte (bevor Osten 1939 eilig nach Deutschland zurückkehrte, weil er den tollen Krieg der Nazis nicht verpassen wollte – er war 1936 in Bombay der Auslandorganisation der NSdAP beigetreten) – Vorläufern bzw. den Anfängen der Hindi-Filmindustrie, besser als Bollywood bekannt. Rai spielt in "Prem Sanyas" (sowas wie "Verzicht auf Liebe", der internationale Verleihtitel war "The Light of Asia") den jungen Prinzen Guatama, der allem weltlichen entsagt und zum Stifter des Buddhismus wird. Das ist voller Exotismen, es wird gekämpft (die Prinzessin – von der indo-britischen Schauspielerin Seeta Devi, damals noch Teenagerin, gekonnt verkörpert – muss schliesslich erobert werden), es wird geschmückt und dem Ornament gefrönt … es wird aber auch durchs Land geritten und gegangen, dem Orientalismus wird durchaus philosophische Authentizität gegenübergestellt, es wurde auch an Originalschauplätzen gedreht und der Film hat im letzten Drittel oder so durchaus die nötige Tiefe und Aufrichtigkeit. (Im Wiki-Eintrag von Rai wird er als Co-Regisseur geführt. Gedreht wurde in Lahore aber u.a. auch in Bodh Gaya (Bihar), wo Buddha angeblich seine Erleuchtung erlebte. Der Film war eine der ersten indischen Ko-Produktionen und die erste, die international vertrieben wurde – mit grösserem Erfolg als im Land selbst, wie es scheint. Auch hier gab es zwei einminütige Vorfilme: "Indes. Cérémonies religieuses musulmanes célébrées à Calcutta" und "Les Funérailles de Monsieur C.R. Das premier maire indien de la ville de Calcutta" (beide FR 1925), die Begleitung war einmal mehr toll, gespielt von Stephen Horne (Klavier) und Eduardo Raon (Harfe).
Auch der dreizehnte Langfilm des unabhängigen afro-amerikanischen Regisseurs Oscar Micheaux stammt aus dem Jahr 1925, Body and Soul* * * *1/2. Es ist der späteste von nur drei seiner Stummfilme, die überliefert sind, und wie es scheint der kohärenteste. Neun Reels dauerte der fertige Film einst, musste für die Zensur aber arg gekürzt werden. Auf dieser fünf Reels langen Fassung beruht die Rekonstruktion (George Eastman Museum, 2023), die 105 Minuten dauert. Paul Robeson spielt zwei völlig gegensätzliche Rollen, zwei Brüder vielleicht: den herzensguten Erfinder Sylvester, in den sich Isabelle (Julia Theresa Russell), die Tochter der hart arbeitenden Wäscherin Martha Jane (Mercedes Gilbert) verliebt (beides Weisse), und den sich als Priester ausgebenden Betrüger Reverend Isaiah T. Jenkins, der spielt und trinkt und die Gemeinde mit harter Hand zu führen scheint. Die Mutter verkehrt mit ihren Kirchenfreundinnen, sie alle sind dem Scharlatan erlegen und Martha Jane löst damit eine Tragödie aus: der "Priester" belästigt die Tochter und lässt sich von ihr die Ersparnisse der Mutter aushändigen – die Tochter zieht in die Stadt, wo sie kaum überleben kann … und natürlich wurde der Film damals auch in afro-amerikanischen Kreise kritisiert wegen ungebührlicher Darstellung eines schwarzen Priesters, aber auch allgemein wegen Szenen, in denen die Afro-Amerikaner als schlechte Menschen gezeigt werden (trinken, Karten spielen, drohen, betrügen, bestehlen…. das alles tut der falsche Priester mit Genuss). Als Vorfilme liefen dieses Mal "Le Boxeur Siki assassiné à New York" (FR 1925, 1') ein krasses Newsreel mit einer riesigen KKK-Parade in Washington, "La Société secrète du Ku Klux Klan défile à Washington" (FR/USA 1925, 2') sowie die Komödie "Red Pepper" (Arvid E. Gillstrom, USA 1925, 16') vom heute ziemlich vergessenen Komiker Al St. John (dem Sohn der älteren Schwester von Roscoe Arbuckle, der wiederum nur sechs Jahre älter war als St. John). Am Klavier sass Meg Morley und auch ihre Begleitung war erstklassig.
 |
| Cinémato-Chikli, Tunis - Projektion vor der Vorstellung im Cinema Lumière, Bologna |
6) PROGETTO SAMAMA CHIKLI
Aus der anderen Jahres-Reihe – Century of Cinema: 1905 – habe ich dieses Jahr nicht viel mitgekriegt, aber zum Progetto Samama Chikli musste ich auch zum dritten Mal in Folge wieder. Es ist jedes Mal toll, was es da zu entdecken gibt! Albert Samama war ein Amateur-Filmer und ein Pionier, der um 1905 herum seine ersten eigenen Filme drehte und vorführte – einer der ersten Filmemacher des afrikanischen Kontinents, geboren in eine wohlhabende jüdisch-tunesische Familie im Jahr 1872. Samamas Vater war ein Bankier des Bey und gründete eine Bank, aus der später die Bank of Tunisia hervorging. Eigentlich war das dieses Jahr nur als ein Programm gedacht: eine gute halbe Stunde mit einem Programm, wie es im Cinémato Chikli in Tunis im Jahr 1905 hätte gezeigt werden können (genaue Programme sind nicht bekannt), was unter der Überschrift Local Screening, Global Production lief. Als Teil zwei gab es dann (im Rahmen der Restored and Recovered-Programmschiene) noch ein halbstündiges Programm, das ganz aus Filmen von Chikli bestand. Mariann Lewinsky betreut diese Reihe (zu der vor einem Jahr auch ein tolles Buch erschienen ist) und machte zwei kurze Einführungen, André Desponds aus Zürich (mir von Stummfilmvorführungen dort aber auch klassischen Konzerten bestens bekannt) sorgte für die passende Begleitung – wie er das gerne macht auch mit Überleitungen zwischen den Filmen (und etwas Schweizer Lokalkolorit, wenn er bei Bildern eines Kamelmarkts das in der Deutschschweiz überall bekannte Chanson "Dr Sidi Abdel Assar vo El Hama" des Berner Liedermachers Mani Matter zitierte – im Saal lachten ausser mir noch zahlreiche andere Leute).
Das internationale Programm enthielt Filme aus den Jahren 1902 bis 1905, vornehmlich aus Frankreich, aber auch zwei tunesische Filme von Chikli – die frühesten bekannten Filme eines lokalen Filmemachers. Der Reihe nach gab es: "Métamorphoses du roi de pique" (Gaston Velle, FR 1903, 3'), "Le Cake-Walk au nouveau cirque" (FR 1902, 5'), "La bonne pipe" (FR 1905, 2'), "Erreur de porte" ([Ferdinand Zecca], FR 1904, 2′), "Fantasia arabe" (FR 1905, 2′), "Un coup d'œil par étage" (FR 1904, 6′), "La Confession" (FR 1905, 2'), "[Les Souks]" (Albert Samama Chikli, TN ohne Jahr, 1'), "La Pêche au thon de Sidi Daoud" (Albert Samama Chikli, TN 1905, 5'), "Dix femmes pour un mari" (Georges Hatot, FR 1905, 4') und schliesslich "Danses algériennes I – Danse des ouled-naïl" (FR 1902, 1'). Besonders toll: die Minikomödie um den Mann, der von zehn Frauen gejagt wird, der Blick der Vermieterin durchs Schlüsselloch auf jeder Etage ihres Wohnhauses (immer dieselbe natürlich, elegant geschnitten, wenn sie wieder die Treppe hochgeht) und die Beichte von Renée Doux (die spanische Schauspielerin in "La Confession") – der Film ist stumm, aber die Reaktion des Priesters lässt uns fast Wort für Wort folgen. Die Tänze stehen für Tanzaufführungen, die wie Musik und Zauberei (einer der Filme zeigt Kartentricks) Teil der Spektakel waren, die in Chiklis Kino in Tunis stattfanden. Chikli zeigte Pathé-Filme, aber deren Cake-Walk ist verloren, drum wurde der am selben Ort und zur selben Zeit gedrehte der Société A. Lumière et ses fils ins Programm aufgenommen.
Beim Chikli-Programm gab es dann (nachdem alle einmal den Saal verlassen und wieder betreten hatten): "Le Bey de Tunis" (TN, 1'), "Pathé Journal 7 juillet 1912" (FR 1912, 2'), "Tunis and Surroundings" (TN 1912, 6'), "L'Oasis de Gabès en Tunisie" (TN/FR 1912, 2'), "[Spectacle au Café Maure]" (ohne Ort und Jahr, 1'), "Les Écoles de l'Alliance Universelle Israélite en Tunisie" (TN 1923, 7′), "Les Ressources économiques de la France: la récolte de l'olive en Tunisie" (TN 1922, 5'), und zuletzt das Fragment von Samamas erstem Spielfilm, Zohra. L'Odyssée d'une jeune française en Tunisie (TN 1921, 16'). Angeregt hatte die Spielfilme (1924 folgte "Ain Al-Ghazal", dessen Rekonstruktion letztes Jahr zu sehen war) seiner Tochter Haydée Chikli, damals 15 oder 16 und Drehbuchautorin sowie Hauptdarstellerin (auch 1924 wieder beides, da dann halt 17 oder 18). Natürlich gibt es auch hier Orientalismus und Exotismus – aber auch im Spielfilm oft genaue Beobachtung des beduinischen Lebens: die Familie reist aus Frankreich an, erleidet Schiffbruch, die Tochter wird vermisst, Beduinen retten sie, dann wird sie von Banditen entführt, schliesslich von einem frz. Piloten gerettet und mit ihren Eltern wieder vereint. Vom Film sind inzwischen 16 rekonstruiert und die fehlenden Stellen wie schon bei der Rekonstruktion von "Ain Al-Ghazal" mit zusätzlichen Zwischentiteln erläutert, damit die Handlung Sinn ergibt – auf Wiki steht da vermutlich Blödsinn, denn gemäss dem Festival-Katalog sind die 16 Minuten gerade mal 189 Meter der ursprünglichen 1500 Meter Film (auf Wiki gibt es eine 11minütige Version und die Gesamtdauer wird mit 35 Minuten angegeben). Auch die Dokumentarfilme, so kurz sie meisten sind, bieten zahlreiche tolle Aufnahmen von Landschaften, Städten, Landwirtschaft (die Olivenernte), Fischerei usw. Die zwei Filme von 1912, "Tunis and Surroundings" sowie "L'Oasis de Gabès en Tunisie" gab es dieses Jahr in kolorierten Versionen.
7) GREAT SMALL GAUGE: OF SONGS AND SOCIETY
Die Musikreihe in kleineren Formaten bot für mich einen Leckerbissen der Extraklasse: die neu restaurierte Fassung (INA, 2025) von Les Grandes Répétitions: Cecil Taylor (Gérard Patris, FR 1968)* * * * *, dem 45minütigen TV-Film aus der von Luc Ferrari konzipierten fünfteiligen Reihe "Les Grandes répétions", deren andere Folgen den Komponisten Olivier Messiaen, Edgar Varèse und Karlheinz Stockhausen sowie dem Dirigenten Hermann Scherchen gewidmet sind. Ich kannte den Film über Taylor zwar schon, aber in einer alten Überspielung (wohl ab VHS) mit zahlreichen defekten und einer Qualität, dass die Dialoge kaum zu verstehen sind. Die Credits werden im Film gesprochen, ein Interview mit Taylor (in 16mm gedreht) wechselt sich ab mit Szenen einer Probe (35mm, drum eigentlich etwas gemogelt, den Film in die Reihe aufzunehmen, aber ich will mich nicht beklagen!), aufgenommen in einem der Häuser um die noble Place des Vosges in Paris. In einem Palais-artigen Setting spielen Taylor (p), Jimmy Lyons (as), Alan Silva (b, perc – im Film als "Ben Silva" – die Musiker werden mit Text im Bild genannt) und Andrew Cyrille (d) verschiedene Passagen aus Stücken Taylors, mal strukturierter, mal freier. Im Gespräch gibt es eine Konfrontation. "He doesn't come from my community" ist Taylors Antwort auf die Frage, was er denn von Karlheinz Stockhausen halte. Dieselbe Antwort auf die Frage nach Bach. Taylor trägt eine dunkle Sonnenbrille in den sepiagetönten Interviewszenen – die Proben sind in Farbe – und wirkt unlustig, launisch … doch in Kombination mit der Probe zeigt sich seine grosse Sensibilität als Musiker, Gestalter, Komponist, Bandleader. Auf die Frage, was er denn studiert habe, meint Taylor: "The people". Und seine Community? Das ist diejenige von "the other side of the tracks", von der anderen Seite der Geleise. Aus der Konfrontation entsteht etwas, der Film ist ein durchaus aussagekräftiges und phantastisch montiertes Portrait geworden, in dem die schnellen Schnitte und Text-Einblendungen (auch als ganze Tafeln, wie man sie von Godard – oder aus dem Stummfilm – kennt) sich der Musik nicht anbiedern sondern eine Art Äquivalent, das zugleich Kontrapunkt ist, herstellen. Grossartig, diesen Film in hervorragender Qualität wieder sehen zu können (in diesem Fall ist, wegen der Musik, DCP gegenüer 35mm wohl wirklich zu bevorzugen, auch wenn eine perfekte 35mm-Kopie sicherlich auch toll gewesen wäre). Weil der Film allein etwas kurz gewesen wäre, gab es danach noch den zweiten Film über Archie Shepp in Algerien, Archie Shepp: We Have Come Back (Ghaouti Bendeddouche, Algeria 1969, 27')* * * *. "We have come back" sagt Shepp im Film irgendwann – wir sind zurück gekommen. Das bezieht sich darauf, dass Shepp drei Monate nach der Teilnahme am Pan-African Cultural Festival im Juli 1969 in Algiers erneut nach Algerien reiste und dort mit Touareg-Musikern zusammentraf und -spielte. Das wird im Film dokumentiert, mit Shepp und seiner Combo (Clifford Thornton an der Trompete, Dave Burrell am Klavier, erneut Alan Silva am Kontrabass, Sunny Murray am Schlagzeug … auch dabei ist ein ziemlich toller Baritonsaxophist (ein Weisser oder Maghrebiner?) – und es gibt um den Titel einige Verwirrung (im Katalog heisst der Film "Archie Shepp ches les Tuaregs", in der Einführung meinte Ehsan Khoshbakht, "We Came Back" sei der korrekte Titel, im Netz heisst der Film dann – wie Shepp im Film sagt – "We Have Come Back"), aber auch bei den Bildern: das erste Tenorsax-Solo im Bild ist auf der Tonspur nämlich ein Trompetensolo während Clifford Thornton erst viel später zu erkennen ist … ob Grachan Moncur III auch dabei war, kann ich nicht sagen, einen Posaunisten gesehen zu haben, kann ich mich nicht erinnern, vielleicht war er nur beim ersten Besuch im Juli dabei und der Barisaxer dann sein Ersatz? Egal, der Fokus ist auff Shepp (es gibt dasselbe später nochmal, einfach mit Barisax auf der Tonspur und Shepp im Bild), der wilde, überschwängliche Soli spielt (oder sich zu den Soli der anderen auf der Leinwand spielend bewegt), die Band gerät eher aus Versehen ein paar Male ins Bild, die Tuareg-Musiker mit ihren Trommeln und Tänzen sind sehr viel präsenter. Und es gibt eine tolle Szene in der Wüste mit Shepp und seinem Sopransaxophon … und natürlich Bilder der Ankunft, der Begegnung, am Flugplatz, auf Strassen usw. Ein Film mit Fehlern, aber dennoch sehr sehenswert – und natürlich mit phantastischer Musik.
Die Musik war beim anderen Film der Reihe, den ich sehen konnte, nicht immer so toll: Festival* * * * Murray Lerners Dokumentation über das Newport Folk Festival (aufgenommen 1963 bis 1965 glaube ich?) aus dem Jahr 1967 wurde in einer 35mm-Kopie (Blow-Up von 16mm) gezeigt. Der Film dokumentiert die Folkies auf den grossen und kleinen Bühnen, ist lange Zeit sehr weiss – mit der Ausnahme von Odetta, die auch auf der Bühne zu sehen ist – , bis dann irgendwann auch die Nebendarsteller zu sehen sind: ganz grossartig Son House, der uns den Blues erklärt (teils im Gegenschnitt mit dem jüdischen Sohn aus gutem Hause, Mike Bloomfield, der in Performances mit Dylan und der Butterfield Blues Band zu sehen ist und sich im Gespräch durchaus reflektiert zeigt. Das besondere am Film ist aber nicht, Dylan oder Baez (oder Seeger oder die übermässig präsenten Peter, Paul & Mary) performen zu sehen sondern der ganze Mix aus Gesprächen mit Zuhörer*innen, von denen viele pointierte Meinungen haben und andere sich spontan zum musizieren zusammenfinden. Wenn Spokes Mashiyane, der Pennywhistle-Gigant aus Südafrika dann aber nach eine Performerin gestellt wird, die lustige Geräusche mit ihren Backen macht, ist das … problematisch. Dafür reflektiert der Film auch bereits die neue Uniformität, die durch die grosse Masse an nichtkonformistischen Menschen entsteht (und entsprechend ist da auch kein Moment der Denunziation von Dylan going electric drin, denn das wäre unredlich, das merkte Lerner wohl). Joan Baez ist zwiespältig, meint die Verehrung der Idole schade den jungen Menschen doch nicht – aber meint auch, es würde nicht schaden, wenn diese etwas häufiger duschen würden (passend dazu streift Lerner (bzw. er und/oder die drei anderen Kamermänner) am frühen Morgen durch die Strassen und Wiesen und an den Strand, wo überall Menschen auf Motorrädern, in Schlafsäcken, auf Kühlerhauben oder in Cabrios schlafen. Ein interessanter Film voller Musik, die von mittelmässig bis erstklassig alles bietet – auch harten elektrischen Blues von Howlin' Wolf (der gemäss Son House aber selbstverständlich kein Blues ist), eine Jug Band, einen religiösen Laienchor, die schräge Judy Collins, Mimi und Nick Farina und ganz viele mehr.
Leider habe ich den Rest der Reihe verpassen müssen, es hätte noch folgende Filme gegeben: "Right On!" von Herbert Danska (USA 1971) über The Last Poets, "Wattstax" von Mel Stuart (USA 1973) über das gleichnamige Festival (ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den kenne bzw. habe mal was längeres über das Festival gesehen), "Dread Beat an' Blood" (Franco Rosso, UK 1979) sowie ein paar Punk-Filme: "Berlin Walls and the Sex Pistols" (Babeth Mondini-VanLoo, NL 1978) und "Who Is Poly Styrene?" (Ted Clisby, UK 1979) und "The Decline of Western Civilisation" (Penelope Spheeris, USA 1981).
8) DOCUMENTS AND DOCUMENTARIES
Die Schiene habe ich dieses Jahr auch fast komplett verpasst – schade finde ich es da v.a. um die Filme von Márta Mészáros, die ich zwar gar nicht kenne, aber die interessant klingen. Ein Kurzfilmprogramm mit vier Dokumentarfilmen (eins ist kein "Film", mehr gleich) und einem kurzen Spielfilm habe ich mir aber anschauen müssen, v.a. wegen Cartier-Bresson, aber auch weil die Filme von François Reichenbach interessant klangen. Mit zwei von ihm ging das Programm los: À la mémoire du rock (FR 1963, 10') ist eine melancholische Umkreisung und Annäherung an das Phänomen des frühen Rock'n'Roll und mehr noch an die jungen Fans, das Publikum bei der "Massive Rock Superparty" im Palais des Sports in Paris. Die Musik bleibt verschattet, distanziert (was gleichermassen Reichenbachs bewusste Entscheidung sei mag wie den leistungsschwachen Verstärkeranlagen jener Tage geschuldet, als die Fans die Musik mit etwas Geschrei noch locker zum Verstummen bringen konnten. Ein schöner kleiner Film, der nicht vorgibt, zu verstehen oder gar zu erklären – er zeigt einfach. Und legt in den schönsten Szenen klassische Musik über die stumm bleibenden Bilder. Dann folgte der Film, der keiner ist: unter dem Titel Nus masculins wurden irgendwann viel später (obwohl, es steht "FR 1954" dazu) stumme Privataufnahmen von Reichenbach zusammenmontiert, 24 Minuten insgesamt, Aufnahmen seiner Freunde auf Reisen in unterschiedlichen Graden von Nacktheit (manchmal auch kurz angezogen) in Blumenwiesen, in Schilfgräsern und Wäldchen am und auf Felsen im Meer in wunderschöner Farbe (Ektachrome). Das hat nichts Voyeuristisches, wirkt vertraut, zart, aber nie wirklich intim. Ein meditativer Fluss aus überaus schönen Bildern von schönen Körpern, die manchmal im Bild inszeniert werden, manchmal scheinbar wie zufällig eingefangen. Da hätte etwas Musik nicht geschadet. Es folgte was als einer der frühesten anthropographischen Filme Italiens gilt, Il pianto delle zitelle (IT 1939, 19') von Giacomo Pozzi-Bellini, der eine jährliche Prozession in den Abruzzen, zum Santuario della Santissimia Trinità in Vallepietra dokumentiert – Religion als Massenpsychose wird direkt erfahrbar in den beeindruckenden Bildern, eingefangen mit nahem aber auch neutralem, ethnographischen Blick. Dann folgte der kurze Spielfilm La partenza (IT 1968, 12') von Jean-Claude Biette, der auf einer autobiographischen Episode beruht (Biette verliess Frankreich 1965, weil auch nach dem Ende des Algerienkrieges noch eine obligatorische 16monatige Militärdienstpflicht bestand). Im Film wird die Episode nach Parma verschoben, von wo ein junger Mann nach Tunesien will, um dort Kinder zu unterrichten (statt nach Tunesien in den obligatorischen Militärdienst – das ergibt keinen Sinn, ich hab das wohl nicht richtig begriffen). Der Film wird dabei zum Portrait eines jungen Mannes, der sein Dasein reflektiert, in der Diskussion mit einem Freund eine Art intellektuelle Exercitien durchführt, die weder der Freund noch das heutige Publikum so ganz nachvollziehen können. Existentialistisches Theater, irgendwie – aber ich will den Film nicht schlechtreden, denn schlecht ist er nun wirklich nicht. Der grosse Hammer folgte dann zm Schluss, mit 34 Minuten auch seinem Thema der substantiellste der Filme, und auch mit seinen Bildern der beeindruckendste: Le Retour von Henri Cartier-Bresson (FR 1945) dokumentiert die Befreiung und Rückkehr von Millionen von Gefangenen, Verschleppten und Vertriebenen nachdem der Nazi-Terror endlich gestoppt werden konnte. Von August bis Oktober 1945 folgte Cartier-Bresson im Auftrag von Amerikanern und Franzosen französischen Rückkehrern aus Konzentrationslagern. Seine Kamera fängt Hoffnung ein, Glück – aber auch Furcht. Krankheit, Tod, die Quälerei auf langen Fussmärschen oder Reisen mit Lastwagen, mit Güterzügen (!), bis zur Luftbrücke der Amerikaner. Bresson hält auf die Gesichter, schafft einfache, kunstlose Bilder, die umso wirksamer sind. Krass. Die einzige Vorstellung, die ohne Applaus endete. Die paar Dutzend Leute im Saal torkelten benommen in die glühende Nachmittagshitze hinaus.
8) DER REST: COLINE SERREAU, KATHARINE HEPBURN & MEHR RECOVERED AND RESTORED
Am Vorabend des offiziellen Festivalbeginns war ich trotz Bahnstreiks zum Glück rechtzeitig da, um Chaos (FR 2001)* * *1/2 von Coline Serreau zu sehen, die auch da war, aber nicht wirklich über ihren Film reden mochte, aber den Satz raushaute: "Life is so tragic, the only think that's left is to laugh." Der Film ist eine gute Mischung aus Komödie und Sozialdrama, ein Frauenfilm, ein Ensemblefilm – mit etwas aufdringlicher aber gut eingesetzter Musik von St Germain … und am Ende, wenn die vier Frauen – die drei Hauptdarstellerinnen plus die kleine Schwester der Prostituierten – zusammen am Meer sitzen – die Aria aus Bachs Goldberg-Variationen für zwei Klavier (arr. Rheinberger?). Ich musste durchaus kurz mal an Claire Denis denken – aber das irre Tempo des Filmes macht daraus etwas ganz anderes – und führt dazu, dass in 109 Minuten ganz viele Stränge Platz finden. Und dass der erste Film schon einer war, in dem die Männer jämmerliche Knilche sind, passte vielleicht ganz gut zu vielem, was ich dieses Jahr sah (nur nicht zu Lewis Milestone).
Aus der Reihe KATHARINE HEPBURN: FEMINIST, ACROBAT AND LOVER schaffte ich nur einen Film, und den wollte ich vor allem wegen der Regisseurin sehen: Christopher Strong von Dorothy Arzner (USA 1933)* * * *, der natürlich "Cynthia Darrington" heissen müsste, denn der Sir Christopher von Colin Clive spielt nur die zweite Geige – hat aber die Macht, die Erfolgsstory der Flugpionierin Lady Cynthia zu brechen und ihren tödlichen Absturz herbeizuführen – weil so ist die Liebe halt, auch wenn die erotische Spannung zwischen Darrington und der Tochter Strongs (Helen Chandler) viel stärker ist als es die zwischen dem Titelmann (ich mag nicht "-held" sagen) und der Fliegerin ist. Ein interessanter Film auf jeden Fall, Pre-Code und entsprechend saucy.
Aus der riesigen Reihe RECOVERED & RESTORED habe ich wie die letzten zwei Jahre so manches verpasst was ich gerne gesehen hätte, aber in paar Sachen gezielt herausgepickt, die sich gut in mein restliches Programm einfügten. Moj Syn* * * *1/2, ein russischer Stummfilm (1928) von Yevgeni Chervyakov fand ich sehr stark – und Alice Zecchinelli hatte auf dem Klavier auch einen Sampler und bot eine sehr elaborierte Musik zum Drama um das Kuckuckskind, das erst vom Feuertod bedroht werden muss, bis der Vater ein Einsehen hat. Düster, kaum Plot, nur packende Bilder, so viele Close-Ups, dass man jeder Regung der Figuren (Anna Sten ist so phantastisch als Mutter wie Gennadiy Michurin als Vater) gebannt verfolgt, jedes Zucken im Gesicht eine Bedeutung kriegt. Der mittlere Teil des Filmes ist leider verloren, so dass er nur 50 Minuten dauert – aber die haben es wahrlich in sich!
Till We Meet Again von Frank Borzage (USA 1944)* * * * gab es am letzten Tag – noch ein Kriegsfilm, dieses Mal über eine junge frz. Nonne, die einem abgeschossenen US-Piloten hilft, wichtige Informationen an die Briten zu liefern. Die Intimität, die Frank Borzage mit seiner Kamera herstellen kann, ist einmal mehr unglaublich – das sind Bilder, wie man sie sonst nur aus dem Stummfilm kennt. Die Nonne (Barbara Britton) und der ihr über sein heimisches Familienglück berichtende Vater (Ray Milland) machen Liebe in Worten und die Kamera fängt das ein. Gross!
Aus den frühen Jahren habe ich u.a. verpasst: The Scarlet Drop (John Ford, USA 1918), 'A Santanotte (Elvira Notari, IT 1922), Erotikon (Gustav Machaty, CS/DE 1929), Die verliebte Firma (Max Ophüls, DE 1932), One Hour with You (Ernst Lubitsch, USA 1932), Rapt (Dimitri Kirsanoff, CH/FR 1934 – sehr schade, da ich gerade Pierre Koralniks tolles Remake sah, aber ich hoffe, den kriege ich dann in Zürich auch mal zu sehen) Ukigumo/Floating Clouds (Mikio Naruse, JP 1955 – eins seiner Meisterwerke, das ich immerhin schon mal gesehen habe), Les Mistons (François Truffaut, FR 1957), Saint Joan (Otto Preminger, USA 1957).
Aus ca. der zweiten Hälfte der Kinogeschichte sah ich noch Seisaku No Tsuma (JP 1965)* * *1/2 von Yasuro Masumura, den ich in vieler Hinsicht sehr interessant fand. Masumura wurde als erster Japaner im Auftrag seines Studios (Daiei) nach Italien geschickt, wo er in Rom bei Fellini, Visconti und Antonioni studierte. Sein Film spielt auf dem Land, in der Zeit des Japanisch-Russischen Krieges (1904/5), eine unabhängige Frau kehrt mit ihrer alten Mutter in ihr Dorf zurück und es entspinnt sich eine unmögliche Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Lieblingssohn des Dorfes, einem aufrechten, patriotischen jungen Mann, der gerade leicht verletzt aus dem Krieg zurück gekehrt ist und als Held gefeiert wird. Das ist alles … der Clash, in so einem ländlichen japanischen Setting Bilder à la Antonioni zu sehen, ist schon heftig, mir war das manchmal auch etwas zu epigonenhaft, auch wenn viel Reiz darin steckt und die Frauenfigur – stark gespielt von Ayako Wakao, die viele Filme mit Masumura machte (den ich noch gar nicht kannte) – ist wirklich interessant, ihr Handeln für uns (Westler zumal) stets nachvollziehbar, auch wenn sie – natürlich – die Ehre des Mannes, seiner Familie, des Dorfes, ja des Kaisers, zerstört, indem sie ihm beim Fest, mit dem seine Rückkehr an die Front gefeiert wird, die Augen aussticht, was natürlich eine Rückkehr in den Krieg verhindert. Die beiden finden danach zusammen – der Film ist ja nicht aus den Dreissigern sondern von 1965.
Eine neue Kopie in 4K und mit wiederhergestellter originaler Cockney-Tonspur im ersten Teil, gibt es auch von Performance (UK 1970)* * * *, dem gemeinsamen Debut von Donald Cammell und Nicolas Roeg, in dem der harte Schuldeneintreiber Chas (James Fox) abtauchen muss, nachdem er die Gang seines schmierigen Bosses gelinkt und einen seiner Kollegen getötet hat, und in einer Hippie-Kommune landet, in der Sir Mick einen engen Verwandten seiner selbst spielt, der sich mit Anita Pallenberg vergnügt (Keith hatte bestimmt Freude?). Da wären Untertitel in einer Sprache, die ich gut beherrsche, schon hilfreich gewesen (englischsprachige Filme sind generell immer nur italienisch untertitelt), aber andererseits ist das alles weniger wichtig: der Plot ist auch so klar und die visuelle Bildsprache ist es, was diesen irren Film auszeichnet. Psychedelisch sind nicht nur die Pilze, die Pherber (Pallenberg) Chas verabreicht, worauf dieser – ein Alpha-Mann, wie es ihn übler nicht geben könnte – quasi mit Turner (Jagger) verschmilzt. Close-Ups von Körpern beim Sex, Autos, Schlägereien, seltsame Kunst, viel Musik (Jack Nitzsche zeichnete verantwortlich, neben einer ganzen Band u.a. mit Ry Cooder ist aber auch Jagger mit einem tollen Song zu hören) … unglaublich vollgestellte Räume im ganzen Haus der Hippies, vom Keller, in dem Chas haust, über die Küche bis zu den Räumen der anderen. Ein betörender und packender Film – der natürlich ein übles Ende nimmt, nehmen muss, weil die Kleinganoven einfach zu doof sind.
Der letzte Film, gestern Abend, war dann nochmal eine grosse Entdeckung: Yi Yi von Edward Yang (TW/JP 2000)* * * *1/2 – ein dreistündiger Film über eine Familie, anhand derer sich eine ganze Welt auffächert. Vom kleinen Yang-yang, der in der Schule von einer Mädchengang gemobbt wird bis zur Grossmutter, die frühzeitig von der den Film eröffnenden Hochzeitsfeier nach Hause will und dann ins Koma fällt – aber noch einmal aufwacht (oder auch nicht?) und der Tochter einen Papierschmetterling faltet. Der Tochter Ting-ting, die den Müll nicht runterbrachte, was die Grossmutter dann wohl tat und danach bewusstlos in der Einfahrt liegend gefunden wird. Ein wunderbarer Film jedenfalls, der auch ein perfekter Abschluss neun intensiver Tage war.
Aus dieser Zeit leider verpasst habe ich u.a.: Winter Kept Us Warm (David Secter, CA 1965), Five Easy Pieces (Don Rafelson, USA 1970), Pink Narcissus (James Bidgood, USA 1971), Sorcerer (William Friedkin, 1977), Killer of Sheep (Charles Burnett, USA 1978), Diva (Jean-Jacques Beineix, FR 1981); und auch Restaurationen von Filmen, die ich schon kenne: Aryaner Din Ratri/Days and Nights in the Forest (Satyajit Ray, IN 1970 – hierfür hätte ich sonst auf was anderes verzichtet), Barry Lyndon (Stanley Kubrick, USA 1975)
(Flurin Casura, 30. Juni 2025)